Personalisierte Medizin in der Orthopädie, Passend gemacht
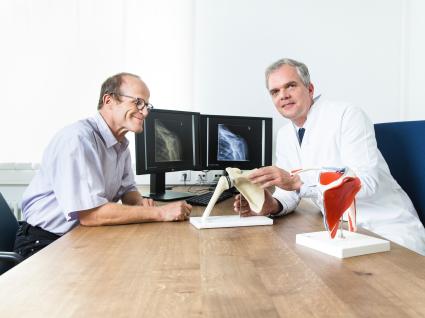
Foto: Prof. Dr. Rupert Meller in einem Patientengespräch am Klinikum Dritter Orden (Foto: Frank Lübke)
Herr Professor Meller, was ist patientenspezifische Instrumentierung in der Endoprothetik?
Prothesen an der Schulter werden heute bei verschiedensten Pathologien eingesetzt. Gleichzeitig steigen die Ansprüche der Patient*innen. Frühere Prothesensysteme haben zwar funktioniert, werden aber dem heutigen Anspruch nicht immer gerecht, Schmerz und Beweglichkeit langfristig zu verbessern und die sogenannten „Standzeiten“ des neuen Gelenks im
Körper zu verlängern. Eine Prothese soll möglichst lange funktionieren. Daher werden wir beim Planen und Einsetzen
von Prothesen immer genauer. PSI ist ein extrem potentes Tool, diese Genauigkeit umzusetzen.
Wie funktioniert es?
Dabei arbeiten wir mit einer Schablone und einer 3-D-Nachbildung der patienteneigenen Gelenkpfanne aus Plastik.
Wie früher machen wir zunächst Röntgenbilder und ein CT, analysieren diese Daten und operieren dann. In unserer „neuen Welt“ mit PSI können wir die Operation aber nicht nur mit sehr guter Softwareunterstützung auf den Millimeter und den Grad genau in 3-D planen, sondern dies auch in den OP transferieren und dort umsetzen. Die beiden Plastikteile aus dem 3-D-Drucker helfen uns, die Prothese perfekt zu platzieren, denn sie sind nur auf diesen einen Patienten, diese eine Patientin abgestimmt und stehen steril während der Operation zur Verfügung.
Wie gehen Sie vor? Haben Sie in der Klinik dafür einen speziellen Drucker?
Nein, so weit sind wir leider noch nicht. Die Software ist höchst aufwändig und wird von diversen Firmen angeboten, genauso wie der Druck. Wenn wir die Patient*innen in der Sprechstunde sehen, prüfen wir, ob sie von PSI profitieren würden. Dazu bekommen sie mindestens zwei bis drei Wochen vor der OP eine hochauflösende Computertomografie, die dann zur 3-D-Planung in die Software eingespielt wird. Die Ingenieur*innen der beteiligten Firmen erstellen daraus
die beiden gedruckten Teile – die Schablone und die Nachbildung der Gelenkpfanne –, die wir etwa eine Woche vor der Operation erhalten. Damit können wir dann sozusagen „spielen“ und die Plausibilität und Passung kontrollieren.
Am Tag vor der Operation werden die patientenspezifischen Instrumente sterilisiert. Während der Operation schließlich
setzen wir die Schablonen an der tatsächlichen Gelenkpfanne der Patient*innen auf. Damit können wir einen Zieldraht platzieren und die Prothese schließlich präzise am richtigen Ort implantieren.
Für welche Patient*innen kommt PSI in Frage?
Theoretisch für alle, die elektiv versorgt werden. Bei einer akuten Fraktur fehlt leider der für die Planung wichtige Vorlauf. Die Standardarthrose kann aber in vielen Fällen wie gehabt operiert werden, wenn die Chirurg*innen genügend Erfahrung damit haben. Nur wenn viel Knochenverlust im Spiel und die Arthrose fortgeschritten ist, denken wir an PSI.
Letztlich muss jede komplexe Deformität im Rahmen einer Schulterarthrose gescreent und mit einem Algorithmus geprüft werden, ob PSI hier einen Mehrwert bietet. Wenn noch genügend Knochensubs- tanz vorhanden ist, benötigen wir sie in der Regel nicht. Sobald aber zu viel abgerieben ist und wir nur einen stark deformierten Knochen zur Verfügung haben, ist PSI indiziert.
Brauchen Sie außerdem noch andere besondere Instrumente oder Systeme?
Nein, der Rest ist dann Routine. Mit PSI können wir nun aber bisher aussichtslose oder potenziell aussichtslose Fälle mit
einer Prothese versorgen. Mit ihrer Hilfe können wir hoch komplexe Knochendefekte wieder aufbauen und das Implantat dann so am Knochen positionieren, dass wir die ursprüngliche Anatomie der Schulter wieder sehr gut rekonstruieren können. Damit gelingt es, die Gelenklinien wieder anatomisch zu rekonstruieren.
In einigen extremen Fällen von Knochenverlusten erstellen wir zusätzlich ein patientenspezifisches Implantat.
Dieses besteht aus Metall und wird ebenfalls von darauf spezialisierten Firmen speziell für die Patient*innen hergestellt. In diesem Fall benötigen wir aber bis zu drei Monate Vorlauf.
Bestimmt sind die Patient*innen von dem neuen System begeistert.
Jein. Für uns Chirurg*innen ist die Methode toll, weil wir damit präoperativ planen können und dadurch mit einem viel besseren Gefühl in die Operation gehen. Mit der Schablone können wir dies im OP umsetzen und so eine perfekte Platzierung erreichen. Für die Patient*innen in den Studien allerdings ist der Mehr- wert bisher leider nicht ersichtlich – ähnlich wie etwa bei Navigation und Robotik an Knie oder Hüfte. Das muss man kritisch erwähnen. Für uns sind das tolle Tools. Nicht alle Operierten aber äußern sich anschließend signifikant glücklicher im Vergleich zu konventionell versorgten Patienten. Einen großen Mehrwert haben allerdings Patient*innen mit einem spezifischen, personalisierten Implantat. Denn damit kann ich auch denjenigen helfen, die ich bisher nicht versorgen hätte können.
Gibt es Beispiele?
Ich denke an eine sehr betagte Patientin, die mit ihrer extremen Arthro- se überhaupt nicht mehr zurechtkam. In der Regel hält man sich als Operateur bei sehr betagten Patient*innen zunächst zurück und rät ihnen eher zu Physiotherapie oder anderen Maßnahmen. Doch all das hat ihr nicht geholfen. Immer wieder kam sie mit extremen Schmerzen zu uns, auch stationär, mitten in der Nacht und am Wochenende. Mit einem patientenspezifischen Implantat konnten wir sie schließlich zur Schmerzfreiheit bringen.
Warum ist der korrekte Einsatz eines künstlichen Schultergelenks manchmal ein Problem?
Die Schulter ist ein relativ komplexes Gelenk. Während der Operation muss ich den Draht für die Platzierung der Pfanne perfekt im dickeren Teil des Knochens platzieren. Wenn ich ihn zu hoch, zu weit vorne oder zu weit hinten
einsetze kommt es zu einer Fehlplatzierung. Eine Abweichung von fünf Grad kann beispiels- weise bedeuten, dass die Pfanne nicht optimal verankert werden kann.
Es ist kaum zu glauben, dass die Patient*innen angesichts all dieser Vorteile keinen Unterschied merken.
Ja, das ist kurios. In verschiedenen internationalen Studien ist es bisher nicht gelungen, das zu zeigen, auch bei Knie- und Hüftprothesen nicht. Wir sehen zwar alle, dass es radiologisch besser ist – alle sagen: „Wow, das ist perfekt platziert“. Aber die Patient*innen sehen bisher keinen Unterschied. Das muss man leider so akzeptieren. Es wird sich zukünftig hoffentlich noch zeigen, dass die Prothese langfristig länger hält. Der Mensch ist nun einmal keine Maschine. Wir kennen das
Phänomen auch von Frakturen an der Schulter. Manche Patient*innen haben nach einer Operation ein perfektes
Röntgenbild, aber sie empfinden die Funktion als schlecht. Andere wurden nicht operiert, sondern konservativ behandelt,
und obwohl das Röntgenbild schauderhaft aussieht, kommen sie gut zurecht. Das Röntgenbild und der klinische Befund stimmen zumindest an der Schulter häufig nicht überein. Bei den unteren Extremitäten, also Hüfte und Knie, ist es anders, weil diese mechanisch mehr belastet werden.
Übernehmen die Kassen die Kosten?
Je nach Anbieter kostet die PSI Schablone zwischen 300 und 700 Euro. Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt dies leider nicht. Bei privaten Kassen kann man anfragen. Leider ziehen sich die meisten Krankenkassen aber auf die oben genannten Studien zurück. Wir Chirurg*innen würden uns oft wünschen, dass sie sehen, in welch schwierigen Situationen wir eine Prothese perfekt platzieren müssen, und dass dieser Mehrwert auch honoriert wird. Eine patientenspezifische Prothese kostet aktuell bis zu 10.000 Euro. In diesem Fall können wir wirklich nur mit einer Genehmigung durch die Krankenkasse operieren, denn sonst wäre das Risiko für den Leistungserbringer zu hoch.
Können wir es uns als Gesellschaft überhaupt leisten, alles zu personalisieren?
Wie gesagt, bei Standard-Arthrosen brauchen wir die PSI nicht. Die Fallzahlen werden immer höher, und es ist ja auch
der politische Wille, dass dies nur wenige Häuser mit hoher Expertise übernehmen. Ich glaube auch, dass es der Weg für die Zukunft sein wird, eine gute Versorgung durch Konzentrierung auf weniger Häuser zu erreichen. PSI wird daher auch künftig wahrscheinlich etwas für ausgewählte Fälle bleiben.
Was, denken Sie, hält die Zukunft für uns im Bereich der Endoprothetik bereit?
Anders als Anfang der Zweitausender sind heute viele ernüchtert, die damals fest an Tissue Engineering –Stichwort Knorpelzelltransplantationen – geglaubt haben. Auf lange Sicht wird vieles im Bereich Biologie passieren,
damit eine Arthrose erst gar nicht entsteht – entweder durch Lebensstiländerungen oder z.B. durch Abnehm-Tabletten.
In den nächsten zehn oder 20 Jahren sehe ich unsere Aufgabe darin, die Prothesensysteme zu optimieren. Sie werden immer modularer, sodass wir sie immer besser auf die Patient*innen abstimmen können. Aus einem Baukastensystem können wir künftig hoffentlich die für die Einzelnen perfekten Kombinationen zusammenstellen und dann implantieren.
Ein weiterer Ansatz ist die Orthobio- logie, bei der quasi eine Eigenbluttherapie an Gelenken vorgenommen wird.
Die Studienlage dazu ist auf den ersten Blick sehr gut, doch aktuell sieht es so aus als könne man die Prothese damit
nur ein paar Monate oder Jahre hinauszögern.
In der Onkologie ist die personalisierte Medizin in aller Munde. Wird dies auch in der orthopädischen Chirurgie kommen?
Die Meilensteine werden hier tatsächlich in der Onkologie oder der Infektiologie erreicht, die uns hier weit voraus sind.
Bei einer manifesten Arthrose befinden wir uns leider immer noch im Bereich der Mechanik und Implantate.
In ferner Zukunft wäre es aber natürlich wünschens- wert, dass es auch im Bereich der Arthrose zu ähnlichen Entwicklungen kommt.
Stephanie Hügler
MÄA 11/2024 vom 18.05.2024
