Digitalisierung in der Kardiologie: Herz und Computer
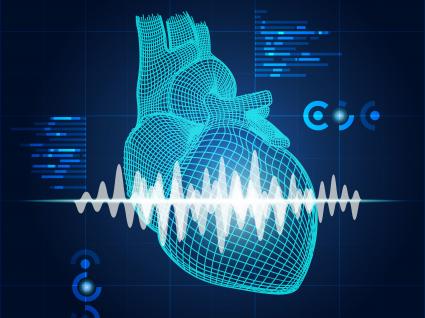
Foto: shutterstock
Die Digitalisierung hat schon eine Weile in der Kardiologie Einzug gehalten. Warum ist das so?
Ein großer Pferdefuß bei kardiologischen Prozeduren ist, dass wir im Gegensatz zum Chirurgen, der einen OP-Situs vor sich hat, gar nicht so genau wissen, wo wir uns bewegen. Wir arbeiten ja in der Regel mit einem Katheter über die Leisten- oder Armgefäße. Damit kann man sich oft nicht gut visuell orientieren. Früher konnte man das Herz mit seinen komplexen Strukturen nur durchleuchten. Über die letzten Jahre sind zunehmend Systeme zur strahlenarmen Visualisierung des Herzens entwickelt worden, die uns auch bestimmte Abläufe besser erklären lassen.
Was leistet die digitale Medizin in der Kardiologie?
Nehmen Sie die Diagnostik und Therapie der koronaren Herzerkrankung und des Herzinfarkts. Dabei müssen wir die betroffenen Gefäße mit einem Kontrastmittel visualisieren. Diese Prozedur war vor Jahren noch wenig digital. Früher als Studenten haben wir uns die aufgenommenen Bildsequenzen angesehen wie einen Film im Kino – abgespielt von einer Filmrolle in schlechter Qualität. Heute können Herzkatheterfilme hochauflösend und digital gespeichert und von überallher übermittelt werden, z.B. an die Kollegen in der Herzchirurgie. So sollten bestimmte Befunde laut Leitlinienempfehlung im Heart Team interdisziplinär besprochen werden. Dabei können wir patientenbezogene Bilder auf digitalem Weg zu den herzchirurgischen Kollegen versenden noch während der Patient bei uns auf dem Herzkathetertisch liegt. Das ist ein riesiger Vorteil.
Geht es vor allem um die digitale Kommunikation?
Nein, auch die Qualität der Diagnostik und Therapie ist durch die Digitalisierung wesentlich besser geworden. Heute können Sie z.B. bei der Koronarangiographie die Bildqualität über digitale Prozesse verbessern statt wie früher die Strahlenintensität zu erhöhen. Ferner können wir heute intraprozedural zur Therapieplanung z.B. mit einem stecknadelgroßen Ultraschallkopf ins Gefäß reinschauen und digitale Bilder, etwa von einer Gefäßplaque bzw. der Plaquezusammensetzung, erstellen. Mit einer Druckdrahtmessung, der sogenannten FFR-Bestimmung, können wir zudem die hämodynamische Relevanz von Engstellen genau beurteilen. Denn wir wissen heute, dass Patienten prognostisch insbesondere dann von einem Stent profitieren, wenn im Gefäß nach der Engstelle zu wenig Blut ankommt. Das können Sie in manchen Fällen nicht sehen, sondern nur physikalisch messen.
Wie sieht es in anderen kardiologischen Bereichen aus?
Ganz relevant wird es im elektrophysiologischen Bereich, vor allem wenn eine komplexe Herzrhythmusstörung vorliegt. Typische Diagnosen sind zum Beispiel Vorhofflimmern, atypisches Vorhofflattern oder Kammerrhythmusstörungen. Mit den heutigen elektroanatomischen Mappingsystemen können wir sehr viel sicherer, schneller, genauer und damit auch erfolgreicher arbeiten. Über Magnetfeld- und Impedanzmessungen mit einer Art GPS-System können wir die Katheter und die kardiale Anatomie strahlenfrei visualisieren – wie einen Comic auf einem Monitor. Das System zeigt uns z.B. genau, wo eine Rhythmusstörung verläuft oder wo sich Narbenareale befinden, und das sehr viel hoch auflösender als vor zehn Jahren. Heute wissen wir auch genau, wie fest wir bei einer Verödung gegen die Herzwand drücken müssen. Prozeduren, für die wir früher fünf Stunden gebraucht haben, können wir heute in zwei durchführen. Das ist wirklich eine revolutionäre Entwicklung.
Seit wann setzen Sie diese Geräte ein?
Alle großen elektrophysiologischen Abteilungen nutzen die Technik, nicht nur wir. Daher kann man eine Behandlung ohne die Technik heute eigentlich nicht mehr anbieten. Die Frage ist nur, wie umfassend eine Klinik jeweils ausgestattet ist. Wir haben seit über einem Jahr einen komplett neuen Katheterbereich mit modernster Technologie. Und natürlich muss man lernen, wie diese Systeme funktionieren.
Gibt es weitere kardiologische Bereiche, in denen digitale Technik angewendet wird?
Sie ist noch in einem dritten Bereich sehr wichtig: bei der Device-Therapie, also etwa bei implantierbaren Schrittmachern, Defibrillatoren, etc. Das sind heute im Prinzip kleine Computer, die irrsinnig viel können: Wir können ihnen zum Beispiel beibringen, Alarm zu schlagen, wenn ein Patient wegen einer Herzschwäche dekompensiert. Die Geräte können das teilweise schon lange voraussagen, bevor der Patient davon irgendetwas merkt. Technisch wäre es sogar möglich, dass das Gerät uns in der Klinik über eine Mail alarmiert, bevor ein solcher Fall eintritt. Allerdings würden wir mit so einem Vorgehen das Feld der Telemedizin stark öffnen, mit allen Konsequenzen.
Welche Konsequenzen meinen Sie damit?
Wenn man sich dafür entscheidet, einem Patienten ein solches Gerät einzusetzen, muss man nicht mehr nur die Patienten betreuen, die vor Ort im Krankenhaus sind, sondern auch die Patienten zu Hause, und das ist personell schwer zu leisten. Mit sogenannten implantierbaren Event-Recordern können wir heute z.B. den Herzrhythmus der Patienten permanent telemedizinisch überwachen. Wenn wir aber pro Woche vier oder fünf solcher Systeme implantieren würden, können wir hochrechnen, wie viele zusätzliche Patienten wir dadurch in einem Jahr hätten und wie viele tausend Meldungen der Geräte wir ständig auswerten müssten. Wir nutzen die telemedizinische Funktion dieser Recorder daher derzeit nur partiell, wenn es relevant für die Prognose eines Patienten ist. In den anderen Fällen müssen die Patienten zum Arzt kommen, um das Gerät auszulesen. Das ist das große Problem bei der Telemedizin: Wir können personell nicht alles machen, was technisch möglich wäre.
Könnte nicht jemand anders dieses Screening übernehmen?
Zwar bieten manche Firmen eigene telemedizinische Servicecenter an, die dies übernehmen könnten. Schlussendlich wird aber doch wieder der behandelnde Arzt kontaktiert, um patientenbezogene Entscheidungen zu treffen. Dieser Bereich der Telemedizin verspricht viel und zeigt in Studien gute Ergebnisse. Eine flächendeckende Umsetzung der Möglichkeiten findet aber meines Wissens derzeit aus besagten Gründen noch nicht statt.
Gibt es auch Eingriffe und Diagnosen, bei denen digitale Medizin nicht angezeigt ist?
Die Kardiologie ist voll von digitaler Medizin. Sobald wir einen Patienten invasiv behandeln ist das zwangsläufig mit digitaler Medizin verbunden. Wir können bestimmte Dinge heute nur durch die digitale Medizin leisten. Die Antwort lautet also: Nein, in der interventionellen Kardiologie oder der Elektrophysiologie gibt es keinen Bereich, in dem die digitale Medizin keine Rolle spielt. Auch in der konventionellen Kardiologie, etwa bei der Herz-Ultraschalldiagnostik, ist sie wichtig: Wir können das Herz heute mit dem Ultraschall dreidimensional darstellen – dabei entstehen ganz phantastische Bilder.
Werden die Geräte auch zu Trainingszwecken genutzt?
Wenn Sie ein elektroanatomisches Mappingsystem einsetzen wollen, müssen Sie das vorher trainieren. Die Herstellerfirmen bieten spezifische Trainings an. Für manche Technologien müssen Sie auch zertifiziert sein, bevor Sie diese anwenden dürfen. Im Bereich der interventionellen Kardiologie gibt es Trainingssysteme mit speziellen Puppen, an denen junge wie auch erfahrene Kardiologen kritische Situationen wie in einem Flugsimulator trainieren können.
Gibt es Studien zu den Vorteilen der digitalen Medizin in der Kardiologie?
Immer wenn neue digitale Technologien in die Leitlinien übernommen werden, gibt es dazu Studien. Die Druckdrahtmessung etwa wurde in eine solche Leitlinie übernommen, weil hiermit Läsionen identifiziert werden konnten, deren Behandlung nachweislich von prognostischer Bedeutung sind. Es gibt zusätzlich viele nicht leitlinienrelevante Studien, die die Vorteile der Technik klar beschreiben: die Reduktion der OP-Zeit, der Strahlenexposition, die Trainierbarkeit und Erhöhung der Sicherheit für den Patienten – prozedural und periprozedural – und in manchen Fällen ein höherer Therapieerfolg.
Können Sie Ärztinnen und Ärzte verstehen, die der Digitalisierung in der Medizin eher kritisch gegenüberstehen?
Ja, denn es gibt auch Bereiche, in denen die Technik dem Arzt die Dinge „aus der Hand“ nimmt. In der Elektrophysiologie gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Katheter ferngesteuert über ein Magnetfeld zu bewegen. Dabei steht der Arzt nicht neben dem Patienten. Dadurch fehlt auch die menschliche Nähe. Neben den immensen Kosten für dieses System ist das vielleicht auch ein Grund, warum sich so eine Technologie bis heute nicht flächendeckend durchgesetzt hat.
Was ist aus Ihrer Sicht im Umgang mit der Technik wichtig?
Nicht jede technische Neuerung muss auch von Vorteil für den Patienten sein. Man darf ferner nicht betriebsblind werden oder seinen klinischen Verstand ausschalten. Wir dürfen nicht vergessen, mit den Menschen zu reden. Mit unseren heutigen Möglichkeiten können wir immer mehr Diagnostik und Therapien durchführen, aber nicht immer sind mehr Untersuchungen auch besser. Manche Diagnosen kann man auch stellen, indem man sich Zeit nimmt, den Patienten zuzuhören und die richtigen Fragen zu stellen. Auch während der Behandlung von Patienten im Katheterlabor ist es wichtig, darauf zu hören, wenn Patienten z.B. sagen, dass es ihnen nicht gut geht – aus Gründen der Patientensicherheit. Man sollte nicht zum Technikfreak werden und den Patienten dabei vergessen, auch wenn die Technik heute sehr faszinierend ist.
Gibt es auch Nachteile der Technik?
Ja, wenn Sie den ganzen Tag in einem elektrophysiologischen Labor verbringen, können Sie davon ausgehen, dass irgendetwas an diesem Tag technisch nicht funktionieren wird. Das ist unabhängig von der Klinik und den technischen Systemen. In 99,9 Prozent aller Fälle stellt dies aber keine Gefährdung für den Patienten dar. Wenn es z.B. einen Stromausfall gibt, wäre das in manchen Situationen nicht gut. Aber wir kennen die Szenarien und haben Exit-Strategien, wie in einem Flugzeug. Ein Stromausfall kann uns z.B. nichts anhaben, weil unsere Backupund Batteriesysteme die Sekunden bis zum Anspringen des Notaggregats überbrücken. Wir stehen also nie im Dunkeln. Aber es kann natürlich vorkommen, dass wir ein System mal herunter- und wieder hochfahren müssen. Das macht die Patienten natürlich unruhig. Daher muss man ihnen die Angst nehmen und alles genau erklären – so wie das auch der Pilot im Flugzeug tut, wenn es z.B. zu Verspätungen kommt.
Das Gespräch führte Stephanie Hügler

